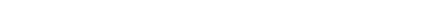Stadt Celle schafft neue Institutionen zur Erstaufnahme und Integration von Geflüchteten
Die Integration der Flüchtlinge wird auf der institutionellen Ebene von den Stadtverwaltungen, den Bildungseinrichtungen und Jobcentern geleistet werden müssen. Vom Ge- oder Misslingen hängt viel für die Zukunft der Gesellschaft ab. Die Bundesregierung tut mit den „Asylpaketen“ und dem sogenannten „Integrationsgesetz“ viel dafür, dass es misslingt. Die Stadt Celle unternimmt aktuell mit der Schaffung einer „Zuwanderungsagentur“ und einem sogenannten „Internationalen Bildungscampus“ eine institutionelle Neuausrichtung ihrer Integrationsarbeit.
Werfen wir zunächst einen Blick auf die aktuelle Situation in Celle. Am 31.12.2015 gab es im Landkreis Celle 1.763 Flüchtlinge, davon in der Stadt Celle 699. Die Verteilung der Flüchtlinge auf die Kommunen erfolgt hier im Verhältnis zu ihrer jeweiligen Einwohnerzahl. Das hat einen unbestreitbaren Vorteil, dass es eine bundesweit gern skandalisierte „Überforderung“ von Kommunen nicht gibt. Der Nachteil: Umverteilungen in Gemeinden, die Wohnungsleerstände haben, gibt es nicht.
Die Städte und Gemeinden im Landkreis sind dann zuständig für die Unterbringung und Auszahlung der Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Die Erledigung der Aufgaben nach dem AsylbLG hat die Kreisverwaltung den Kommunen übertragen, die ab Januar für ihren damit verbundenen Verwaltungsaufwand 1.100 Euro pro Person und Jahr erhalten. Bekommen die Flüchtlinge eine Aufenthaltserlaubnis, wechseln sie zum Jobcenter und bekommen Leistungen nach dem SGB II („Hartz IV“).
Zentrale Anlaufstelle
 Die Stadt Celle hat zum Jahresbeginn 2015 mit der Einrichtung der „Zentralen Anlaufstelle der Stadt Celle (ZA)“ früh auf die steigenden Flüchtlingszahlen reagiert. Alle der Stadt zugewiesenen Asylsuchenden sollen die ZA durchlaufen. Hierfür hat die Stadt Gebäude auf dem Gelände des CJD am Maschweg im Ortsteil Westercelle zunächst angemietet, dann gekauft. Im Konzept heißt es:
Die Stadt Celle hat zum Jahresbeginn 2015 mit der Einrichtung der „Zentralen Anlaufstelle der Stadt Celle (ZA)“ früh auf die steigenden Flüchtlingszahlen reagiert. Alle der Stadt zugewiesenen Asylsuchenden sollen die ZA durchlaufen. Hierfür hat die Stadt Gebäude auf dem Gelände des CJD am Maschweg im Ortsteil Westercelle zunächst angemietet, dann gekauft. Im Konzept heißt es:
„Am Maschweg werden die Neuankömmlinge in Empfang genommen, beziehen ihre Wohneinheit und verbleiben hier für 3 bis 4 Wochen. In dieser Zeit erhalten sie vor Ort eine Einweisung in Grundzüge der deutschen Sprache und einen Einblick darüber, „wie Leben in Deutschland funktioniert“. Vom Gelben Sack bis zur Erklärung von Schulsystem, Kita oder den Hilfesystemen. Ehrenamtliche – z.B. auch Integrationslotsen – helfen direkt vor Ort. Auch z.B. über Patenschaften könnte man nachdenken. Nach 3 – 4 Wochen (in Ausnahmefällen vielleicht auch einmal länger) entlassen wir die Neuankömmlinge in von uns angemietete Wohnungen, die im Vorfeld passgenau eingerichtet werden.“
Die dezentrale Unterbringung in Wohnungen hat in Celle bisher sehr gut geklappt, weil die Voraussetzungen vorhanden sind: Durch den Abzug des britischen Militärs gab es große Leerstände in Vorwerk, Klein-Hehlen und der Heese. Für diese hat die Stadt Nutzungsverträge mit dem Eigentümer, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) geschlossen. Mit einem Info-Point-Konzept bietet die Verwaltung in diesen Stadtteilen auch Anlaufstellen für Geflüchtete und Ehrenamtliche. Und über die Einbeziehung von ehrenamtlichen Helfer*innen konnte bisher auch das „Fremdeln“ der Alteingesessenen weitgehend im Rahmen gehalten werden.
Die Verwaltung hat in ihrem Konzept und in diesem Jahr seitens Stadtrat Kassel nochmal öffentlich zugesichert, dass bei Familien mit kleinen oder schulpflichtigen Kindern ein Verbleib im bisherigen Stadtquartier angestrebt wird, um so Kita- oder Schulwechsel zu vermeiden. Erhalten die Flüchtlinge nämlich eine Aufenthaltserlaubnis, müssten sie eigentlich aus diesen Wohnungen raus. Bei gleichbleibend hohen Zahlen von in Deutschland Schutz suchenden Menschen wie im vergangenen Jahr könnte es in dieser Hinsicht Probleme geben. Die dezentrale Integration in die Stadtteile bleibt aber einer der wichtigsten Bausteine von Integration.
Die ZA hat sich in Kombination mit der Stadtteilarbeit insgesamt als schlüssiges Konzept erwiesen – selbstverständlich wäre in personeller Hinsicht mehr möglich und wünschenswert.
Zuwanderungsagentur ...
 Die gesamte Celler Flüchtlings-„Verwaltung“ und der Betrieb einer Notunterkunft an der Hohen Wende wird in einen Eigenbetrieb der Stadt ausgelagert. Wie kam es dazu und was soll das?
Die gesamte Celler Flüchtlings-„Verwaltung“ und der Betrieb einer Notunterkunft an der Hohen Wende wird in einen Eigenbetrieb der Stadt ausgelagert. Wie kam es dazu und was soll das?
Wenn es um die Nachnutzung leerstehender Kasernenanlagen geht, ist beim Brainstorming eins klar: Genannt werden Hochschule und Flüchtlingslager. Mit dem Areal der von den Nazis errichteten ehemaligen Seeckt-Kaserne (bzw. unter den Briten „Trenchard Barracks“) hat die Stadt eine solche Rüstungsaltlast, die zudem aus denkmalpflegerischen Gründen nicht platt gemacht werden darf. Im Sommer letzten Jahres hegten Politik und Verwaltung noch das hehre Ziel, dort mit einem Ableger der Lüneburger Leuphana Universität den Beginn für einen „Hochschulstandort“ schaffen zu können. Der dafür auf den Weg gebrachte Bebauungsplan trägt dann auch den Namen „Sondergebiet Campus Hohe Wende“ (als „Campus“ wird gemeinhin ein Zusammenhang mehrerer universitärer Einrichtungen bezeichnet). Und als die Zahl der nach Deutschland Geflüchteten im vergangenen Herbst die vorhandenen Kapazitäten in den Erstaufnahmeeinrichtungen bei weitem überstieg, kam selbstverständlich auch dafür die Kaserne ins Gespräch.
Im Oktober 2015 gab es seitens des Landes das Angebot, dass Kommunen die Erstunterbringung in Notunterkünften im staatlichen Auftrag gegen eine kostendeckende Erstattung übernehmen könnten. Der Rat gab hierfür mit großer Mehrheit „grünes Licht“. Und in der Chefetage des Rathauses entwickelte sich aus der Campus-Idee ein regelrechtes Brain-Gaining. (Als Brain-Gain werden die volkswirtschaftlichen Potenziale der Zuwanderung von Fachkräften bezeichnet.) Gleich in der Notunterkunft soll – so die Idee – mit Ausbildung und Qualifizierung der Flüchtlinge begonnen werden. (Ob das in den ersten Wochen nach der Ankunft in Deutschland tatsächlich mit dem verständlich Wunsch, mal zur Ruhe zu kommen, in Einklang zu bringen ist, muss sich zeigen.)
Die der Landesaufnahmebehörde Braunschweig zugeordnete Notunterkunft war mit einer Kapazität von 500 Plätzen konzipiert. Sie soll bis spätestens zum 1. Oktober 2016 die Arbeit aufnehmen. Die Stadt hat hierfür mit dem Land Niedersachsen eine sogenannte Verwaltungsvereinbarung getroffen. Was genau darin geregelt ist, bleibt der Öffentlichkeit vorenthalten. In der Ratssitzung zum Thema verzichtete die Verwaltung gar auf einen Vortrag zum Thema. Hinter den Kulissen ist zu hören, dass die Stadt eine belegungsunabhängige Pauschale erhält, die in irgendeiner Weise mit dem Standardsatz von 45 Euro pro Platz und Tag verkoppelt werden soll. Die Erstinstandsetzung in Höhe von knapp 8 Millionen Euro soll der Stadt vom Bund ersetzt werden.
… als Eigenbetrieb
 Diesen Betrieb aus dem regulären Haushalt der Stadt auszugliedern, erscheint auf den ersten Blick sinnvoll, weil es Transparenz gegenüber dem Land in Kostenfragen schafft. Zunächst war hierfür eine GmbH, dann eine „Anstalt öffentlichen Rechts“ im Gespräch. Unter steuerlichen Gesichtspunkten wurde es schließlich der sogenannte Eigenbetrieb. (Wir haben in der Nummer 78 hinsichtlich der Umwandlung der städtischen Abwasserwirtschaft in einen Eigenbetrieb ausführlich darüber berichtet; deshalb hier nur soviel:) Die wirtschaftliche Selbständigkeit des Eigenbetriebs drückt sich aus in einer Trennung vom Kernhaushalt der Stadt, d.h. einem eigenem Rechnungswesen, Wirtschafts- und Stellenplan. Eine „Betriebsleitung“ verantwortet die Geschäfte. Ein „Betriebsausschuss“ übernimmt Aufgaben des Rates. Maßgeblich zur Führung des Eigenbetriebes ist die Betriebssatzung, die Rechte und Pflichten im Verhältnis Kommune und Eigenbetrieb festlegt. All das hat der Rat in seiner letzten Sitzung verabschiedet.
Diesen Betrieb aus dem regulären Haushalt der Stadt auszugliedern, erscheint auf den ersten Blick sinnvoll, weil es Transparenz gegenüber dem Land in Kostenfragen schafft. Zunächst war hierfür eine GmbH, dann eine „Anstalt öffentlichen Rechts“ im Gespräch. Unter steuerlichen Gesichtspunkten wurde es schließlich der sogenannte Eigenbetrieb. (Wir haben in der Nummer 78 hinsichtlich der Umwandlung der städtischen Abwasserwirtschaft in einen Eigenbetrieb ausführlich darüber berichtet; deshalb hier nur soviel:) Die wirtschaftliche Selbständigkeit des Eigenbetriebs drückt sich aus in einer Trennung vom Kernhaushalt der Stadt, d.h. einem eigenem Rechnungswesen, Wirtschafts- und Stellenplan. Eine „Betriebsleitung“ verantwortet die Geschäfte. Ein „Betriebsausschuss“ übernimmt Aufgaben des Rates. Maßgeblich zur Führung des Eigenbetriebes ist die Betriebssatzung, die Rechte und Pflichten im Verhältnis Kommune und Eigenbetrieb festlegt. All das hat der Rat in seiner letzten Sitzung verabschiedet.
Nicht unbedingt nachvollziehbar ist, dass die Stadt in diesen Eigenbetrieb auch alles eingliedert, was im Flüchtlingsbereich ihre eigene, kommunale Aufgabe ist (mit Ausnahme des Bereichs der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die in großen Teilen nach dem Jugendhilferecht betreut werden). Das macht das Ganze dann wiederum völlig intransparent.
Der Betrieb von Flüchtlingsnotunterkünften dürfte den Betreibern, bisher in der Regel Wohlfahrtverbänden, erhebliche Überschüsse beschert haben. Insoweit ist es seitens der Stadt auch als Geschäftsidee zu sehen. Die Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs belaufen sich ab 2017 auf rund 12-13 Millionen Euro. Unterm Strich ergibt sich – auf den ersten Blick erstaunlich – ein Defizit: rund 500.000 Euro im Jahr 2017, rund 750.000 im Jahr 2018 und fast eine Million im Jahr 2019. Wieso halst sich die Stadt weitere Defizite auf? Die Antwort dürfte so lauten: Diese Defizite entstehen, weil originär städtische Aufgaben eben auch in den Eigenbetrieb ausgelagert werden. Und wahrscheinlich wird der städtische Kernhaushalt in einer Weise entlastet, der die Defizite des Eigenbetriebs bei weitem ausgleicht. Das dürfte in finanzieller Hinsicht die Spielidee sein.
Der Stellenplan des neuen Betriebs mit dem Namen „Zuwanderungsagentur“ hat für das Haushaltsjahr 2016 72,5 Stellen; u.a. eine*n Betriebsleiter*in, vier Abteilungsleiter*innen, 17 Sozialpädagog*innen/erzieher*innen etc., 13 Dolmetscher*innen, rund 20 für Hauswirtschaft, Technik etc.. Das werden – gerade auf der Leitungsebene – zu einem großen Teil Beschäftigte sein, die aktuell schon bei der Stadt arbeiten.
Die politische „Kontrolle“ liegt nicht mehr beim Stadtrat, sondern bei einem „Betriebsausschusses“, der wie folgt besetzt ist: Hannelore Fudeus, Heiko Gevers (CDU), Jürgen Rentsch (SPD), Bernd Zobel (Bündnis 90/Die Grünen), Iris Fiss (Die Unabhängigen) Torsten Schoeps (WG) – und mit beratender Stimme: Ralf Blidon (FDP) und Behiye Uca (Die Linke/BSG).
Das gesamte Paket setzt darauf – und das ist vielleicht das Erfreuliche daran –, dass auch in den folgenden Jahren jeweils Hunderttausende Menschen einen Weg nach Deutschland finden.
Internationaler Bildungscampus Celle
Die Kanzlerin hatte für ihre Entscheidung vom 4. September 2015, Flüchtlinge ins Land zu lassen, immer den Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) auf ihrer Seite. Der hat angesichts der bekannten demografischen Probleme ein Interesse an frischem Humankapital – und genau das stand im Herbst nicht nur vor Europas Grenzen, sondern war zu Tausenden schon mitten drin. Und dieses „Humankapital“ kann sich im Großen und Ganzen wohl sehen lassen: Zumeist junge Menschen, die zu einem großen Teil noch durch die durchaus modernen Schulsysteme Syriens, des Irak und Iran ausgebildet wurden, bevor westliche Interventionen und Saudi-Arabiens IS-Terroristen sie kaputt gemacht haben. Aber: Darauf lässt sich aufbauen, lautet die optimistische Perspektive. Was es braucht, ist aber eine schnelles und effektives Update für den deutschen Arbeitsmarkt.
Selbstverständlich geht es – um mal die Perspektive zu wechseln – auch den Geflüchteten, nachdem sie Schutz vor Krieg und Verfolgung gefunden haben, um ihre Zukunft und die ihrer Kinder. Spracherwerb und Bildung sind dann dafür notwendige Voraussetzungen.
Mit dem Gelände an der Hohen Wende verbinden Rat und Verwaltung die „Vision“, dort Bildungsinstitutionen anzusiedeln. Da Kooperation mit der Leuphana Universität Lüneburg allerdings ist bis auf weiteres geplatzt. Die von OB Mende ins Gespräch gebrachte Idee einer überregionalen Aus- und Fortbildungseinrichtung für den Bereich Altenpflege ist über den Zustand einer Idee bisher anscheinend nicht hinausgekommen.
Nun soll es ein „Internationaler Bildungscampus“ werden. Der zugrunde liegende Gedanke: Geflüchtete werden sofort nach ihrer Ankunft auf Schule und Arbeitsmarkt vorbereitet. Die Stadt stellt also auf dem Campus Räumlichkeiten für Bildungsträger zur Verfügung. Gleichzeitig werden die Bildungsangebote für die der Stadt zugewiesenen Flüchtlinge (also jene, die mittelfristig hier leben) ebenfalls dorthin verlagert. Ob und inwieweit die Bildungsträger, die ja über eigene Standorte verfügen, da mitspielen, ist eine offene Frage. Schließlich werden sie die Räumlichkeiten an der Hohen Wende auch nicht mietfrei bekommen. Zudem stehen die Bildungsträger in Konkurrenz zueinander.
Einen enormen Push allerdings könnte dieses Konzept bekommen, wenn die Stadt auf europäische Fördermittel zugreifen könnte. Hier wurde ein Antrag zum Programm „Urban Innovative Actions“ (UIA – innovative Maßnahmen für die nachhaltige Stadtentwicklung) der Europäischen Kommission gestellt. Einer der Bereiche dieses Programms ist die „Integration von Migranten und Flüchtlingen“. Die EU führt dazu aus, dass eine wohl durchdachte Migrationspolitik entscheidender Bestandteil einer effektiven städtischen Entwicklung ist.
In ihrem Antrag beschreibt die Stadt ihr Ansinnen so: „Ziel des Vorhabens ist u.a. die Bündelung vielfältiger Bildungsangebote von der bilingualen (deutsch/englisch) frühkindlichen Erziehung über Sprachförderung bis zur Ausbildung und Qualifizierung von Flüchtlingen und Asylbewerbern jeden Alters unter Einbeziehung von Akteuren aus Bildung, Soziales und Wirtschaft.“
 Und etwas konkreter heißt es:
Und etwas konkreter heißt es:
„Der Integrierte Bildungscampus Celle (IBC) verfolgt den Ansatz:
1. Errichtung und Betrieb eines Kompetenzcenters zur Kompetenzfeststellung mit einem Qualifikationspass durch praktische Tätigkeit vor Ort im Rahmen der Celler Zuwanderungsagentur. Bei nicht ausreichender Kompetenz für den Arbeitsmarkt bzw. nicht reichenden Deutschkenntnissen finden Sprachkurse in einem geplanten Sprachförderzentrum statt.
2. Existieren die erforderlichen Kompetenzen und Sprachkenntnisse, unterstützen die Kooperationspartner die Entwicklung. Dies sind die Arbeitsagenturen, die im engen Kontakt mit regionalen Unternehmen Qualifizierungsmaßnahmen durchführen und weitervermitteln.
3. Eine Werkstattschule soll die Menschen durch Arbeitsgelegenheiten, wie z.B. den Anbau eines „sozialen Gartens“, fit für den Arbeitsmarkt machen. [...]
4. Damit Menschen im erwerbsfähigen Alter die angebotenen Sprachkurse und Qualifizierungsangebote vor Ort nutzen können wird ein möglichst bilingualer (deutsch/englisch) Kindergarten errichtet. In diesem Kindergarten werden Kinder aus Zuwandererfamilien gemeinsam mit Kindern aus der Mehrheitsgesellschaft betreut. Wir wollen damit von Anfang an einen „normalen“ Umgang untereinander fördern.
5. Ein Familienzentrum soll Raum für Begegnung und Austausch bieten und Plattform für gemeinsame Aktionen und Veranstaltungen sein. Ein interkulturelles Stadtteilcafe sowie Räume für Ehrenamtliche sollen die Atmosphäre abrunden.“
Beantragt wurden Mittel in Höhe von gut 7 Millionen Euro. Für den bilingualen Kindergarten soll eine Kofinanzierung durch einen Investor erfolgen. Die Stadt hofft auf eine Förderung in Höhe von 5 Millionen Euro. Eine Entscheidung der EU wird für Oktober erwartet.
Insgesamt allerdings gibt es bei dem Konzept viele Unwägbarkeiten. Einen ersten Dämpfer erhielt die Stadt bereits bei der Genehmigung des Haushalts für den Eigenbetrieb durch das Land. Statt 500 Plätze geht es – angesichts aktuell gesunkener Zahlen von nach Deutschland kommenden Flüchtlingen – nur noch von einer Kapazität von 250 Plätzen aus. Ob damit die Kalkulation der Stadt überhaupt aufgeht, wurde bisher weder thematisiert, noch beantwortet.
Trotzdem: Die Idee des Internationalen Bildungscampus sendet ein Signal an die Geflüchteten und an die Stadtgesellschaft – ein Signal auf der Linie der viel bemühten „Willkommenskultur“.
Fotos: BIMA
***
Dreiklassengesellschaft
Integration – das heißt in erster Linie Spracherwerb. Für die schulpflichtigen Kinder der Geflüchteten läuft dies in Niedersachsen über Sprachförderklassen an den Regelschulen. Dafür gibt es unterschiedliche Konzepte, aber es scheint einigermaßen zu klappen. Für nicht mehr schulpflichtige Jugendliche bis 21 Jahren gibt es an den Berufsbildenden Schulen sogenannte SPRINT-Klassen, die auch im wesentlichen auf den Spracherwerb ausgerichtet sind.
Bei den Erwachsenen beginnt für in den letzten Monaten nach Deutschland gekommene Flüchtlinge die Drei-Klassen-Gesellschaft.
Zugang zu den Integrationskursen erhalten nur Geflüchtete mit „guter Bleibeperspektive“. Das sind für die Bundesregierung Menschen, die aus Herkunftsländern mit einer Schutzquote von über 50 Prozent kommen. 2015 trifft dies auf die Herkunftsländer Eritrea, Irak, Iran und Syrien zu. Welche Herkunftsländer das Kriterium Schutzquote erfüllen, wird jährlich neu festgelegt.
Die Integrationskurse werden in Celle von der VHS angeboten und umfassen 660 bis maximal 960 Unterrichtseinheiten bzw. wo daneben eine Alphabetisierung 960 bis maximal 1260 Unterrichtseinheiten.
Geflüchtete aus anderen Herkunftsländern müssen eine „Arbeitserlaubnis“ haben (und das Sprachniveau A1). Dann öffnen sich für diese Gruppe über das sogenannte ESF-BAMF-Programm berufsbezogene Sprachkurse. Diese verbinden Deutschunterricht, berufliche Qualifizierung und die Möglichkeit, einen Beruf durch ein Praktikum näher kennen zu lernen.
Keine „Arbeitserlaubnis“ und damit auch keinen Zugang zu Integrationsangeboten erhalten Menschen aus einem den so genannten sicheren Herkunftsstaaten (Serbien, Mazedonien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Albanien, Ghana und Senegal), die nach dem 31. August 2015 einen Asylantrag gestellt haben und deren Antrag abgelehnt wurde.