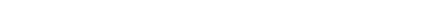„Hört mal her, ihr Zeitgenossen“
 Einen eher unscheinbaren Rekord dürfte Fritz Grasshoff in Celle halten. Nur knapp acht Monate nach seinem Tod am 9. Februar 1997 ehrte ihn der Rat mit einem Straßennamen. Dass es nur eine Gasse ist, die keine Anwohner*innen hat, passt schon: Denn der bekannteste Grasshoff ist jener der Gassenhauer. Nun schlängelt sich die Gasse ums Kunstmuseum herum, was einerseits passt: denn Grasshoffs eigentliche Passion war wohl die Malerei - andererseits einer gewissen Ironie nicht entbehrt: denn der Hausherr dürfte beim Namen Grasshoff eher die Nase rümpfen. Aber auch das passt wieder: denn als Maler fühlte sich Grasshoff eher verkannt. (Die Ausstellung zum 100. Geburtstag am 14.12. macht dann übrigens auch das Bomann-Museum.)
Einen eher unscheinbaren Rekord dürfte Fritz Grasshoff in Celle halten. Nur knapp acht Monate nach seinem Tod am 9. Februar 1997 ehrte ihn der Rat mit einem Straßennamen. Dass es nur eine Gasse ist, die keine Anwohner*innen hat, passt schon: Denn der bekannteste Grasshoff ist jener der Gassenhauer. Nun schlängelt sich die Gasse ums Kunstmuseum herum, was einerseits passt: denn Grasshoffs eigentliche Passion war wohl die Malerei - andererseits einer gewissen Ironie nicht entbehrt: denn der Hausherr dürfte beim Namen Grasshoff eher die Nase rümpfen. Aber auch das passt wieder: denn als Maler fühlte sich Grasshoff eher verkannt. (Die Ausstellung zum 100. Geburtstag am 14.12. macht dann übrigens auch das Bomann-Museum.)
Die Straßennamensehrung beförderte vor einigen Jahren etwas ans Licht, dass der Malerpoet selbst in der Dunkelkammer seiner Biografie hatte verschwinden lassen: Die Mitgliedsnummer 6.038.064. Ja, Grasshoff war Pg. - in einem Nachruf schrieb Oskar Ansull noch, Grasshoffs Versuch, Lehrer zu werden, sei gescheitert, "da er sich 1935 weigerte, der Partei beizutreten". 1935 musste man sich gar nicht weigern; die Mitgliedersperre der NSDAP wurde erst am 20. April 1937 gelockert - und am 1. Mai des Jahres gehörte Grasshoff dann dazu.
Mölze
Immerhin erweisen sich bekanntlich einige Exemplare unserer Gattung gelegentlich als lernfähig. Und eins ist bei Grasshoff nach sechs Jahren Wehrmacht unumstößlicher Bestandteil seiner Gesinnung: Er hasst das Militär wie die Pest. Damit war er auch ein Gegner der Wiederbewaffnung wie auch des postfaschistischem Miefs der 1950er und 1960er Jahre. Und daraus speist sich dann offensichtlich auch sein eher ambivalentes Verhältnis zu Celle, in dem er zwischen 1946 und 1967 lebte. In einem Briefwechsel mit Oskar Ansull und RWLE Möller kommt dies schön zum Vorschein. Die beiden wollten ihn in ihre cellomansische Hassliebe einbinden; er antwortete am 6. Mai 1989 aus Kanada so - und brachte dabei den Namen "Mölze" ins Spiel, mit dem er Celle in seinem Roman "Der blaue Heinrich" beehrte:
"In "Mölze" haben wir (u.a.) einen gemeinsamen Knochen, an dem zu kauen ich einst das Vergnügen hatte. Sie aber haben weiter daran zu kauen, solange sie dort hausen. Doch seien Sie sicher: es gibt überall Knochen, daran zu nagen. Auch hier - wenn man will. Ich allerdings pfeife mehr auf dergl beinerne Röhren, als dass ich daran nage. (Denn meine Situation u. mein Gebiß haben sich geändert. So betrachte ich eo ipso die Cellensia wie Kuriositäten etwa eines mexikanischen Naturkunde-Museums, die mir - zumal aus der Ferne - fast niedlich erscheinen und absolut geruchlos sind. Sie aber stehen beide in diesem penetranten Gelände u. müssen sich wohl oder übel durchbeißen. Nur bedenken Sie: "Mölze" ist auf Sumpf gebaut, und Sie haben es dort allermeist mit einer Art Schildkröten zu tun, stahlhart gepanzerten."
Was hielt den Mann dann aber eigentlich so lange in der Stadt? In erster Linie wohl ein "Fräulein Freudenberg", jene "Roswitha", der er den "Blauen Heinrich" widmete - und die ihm lebenslang das war, was man Muse nennt.
Mauve
Als Grasshoff für das Mai-Heft des "Merian" ("Die Lüneburger Heide") 1966 gebeten wird, auf die Frage zu antworten: "Warum ich in Celle wohne", gibt sie, "die Schwarze", wie er sie nennt, ihm in dem kleinen Text den entscheidenden Hinweis. Denn: "Sie ist eine waschechte Cellenserin, obwohl Polen, Juden und Kreter sie für sich beschlagnahmen." Und sie bringt ihn auf das, was sich für ihn mit Celle verbindet: Mauve. "Mauve ist in Paris erfunden und deshalb etwas ganz Feines. Mauve entsteht durch Brechung des Abendlichtes an den Schmutzpartikeln der Dunstglocke über der Seine-Metropole. Es ist eine Farbe, ein Timbre, eine Nuance, ein Scheneszäkua, wehes Raunen verewigter Mätressen vor der verschlossenen Himmelspforte, es riecht nach Haschisch und Diesel, schmeckt ein bißchen bitter wie Schultinte und Angostura, erzeugt zuweilen eine wabernde Angst am Zwerchfell und erinnert, je tiefer die Sonne sinkt, an die schwarzlila gefrorenen Füße des heiligen Franz, da er den Hochöfen predigt. Mauve ist mauve, und mauve heißt Malve. Und dieses kostbare Mauve ist in Celle zu haben, in der Zeit der frühen Dämmerungen, ab Oktober. Am schönsten, am reinsten, am tiefsten über der Bahnhofstraße. Wie oft habe ich Celler Mauve gemalt! Abstrakt versteht sich. Nonfigurativ. Ach! Wenn die Lampen grün aufflammen wie Aperitifs aus Phosphor und Kleinstadtsünde. Wenn Dämmerung plus Hausbranddunst und Auspuffgase um Strauch und Baum der Trift weben, sich der Abendstern dazugesellt und gar die alte Zuchthausglocke pingelt, dann ist das eine Wolke, dann ist das einfach marecagé sur chaussette oder Angelique á la framboise mit Bauchdekollete bußfertig auf der Treppe der Madeleine. Ich kann Celler Mauve nicht mehr entbehren. - So weit über "das" Mauve. Es gibt aber außerdem noch "den" Mauve. Der Mauve ist ein Original Pariser Petticoat der Schwarzen, meiner Gattin (Verlobungsgeschenk eines Vorgängers), und ihn hat sie natürlich in erster Linie gemeint. Besagtes Kleidungsstück (als pars pro toto) hatte mich vor Jahren veranlaßt, Celle nicht den Rücken zu kehren, als die Schwarze noch Fräulein Freudenberg war und ich schon abzudampfen gedachte, um in Frankfurt den Posten eines Raststätten-Syndikus anzunehmen oder jenseits des Rheines Mist zu karren, wenn ich als Pflastermaler versagt hätte." (Ein Jahr später verließ Grasshoff übrigens Celle und siedelte um nach Zwingenberg an der Weinstraße.)
"Mauve ist in Paris erfunden und deshalb etwas ganz Feines. Mauve entsteht durch Brechung des Abendlichtes an den Schmutzpartikeln der Dunstglocke über der Seine-Metropole. Es ist eine Farbe, ein Timbre, eine Nuance, ein Scheneszäkua, wehes Raunen verewigter Mätressen vor der verschlossenen Himmelspforte, es riecht nach Haschisch und Diesel, schmeckt ein bißchen bitter wie Schultinte und Angostura, erzeugt zuweilen eine wabernde Angst am Zwerchfell und erinnert, je tiefer die Sonne sinkt, an die schwarzlila gefrorenen Füße des heiligen Franz, da er den Hochöfen predigt. Mauve ist mauve, und mauve heißt Malve. Und dieses kostbare Mauve ist in Celle zu haben, in der Zeit der frühen Dämmerungen, ab Oktober. Am schönsten, am reinsten, am tiefsten über der Bahnhofstraße. Wie oft habe ich Celler Mauve gemalt! Abstrakt versteht sich. Nonfigurativ. Ach! Wenn die Lampen grün aufflammen wie Aperitifs aus Phosphor und Kleinstadtsünde. Wenn Dämmerung plus Hausbranddunst und Auspuffgase um Strauch und Baum der Trift weben, sich der Abendstern dazugesellt und gar die alte Zuchthausglocke pingelt, dann ist das eine Wolke, dann ist das einfach marecagé sur chaussette oder Angelique á la framboise mit Bauchdekollete bußfertig auf der Treppe der Madeleine. Ich kann Celler Mauve nicht mehr entbehren. - So weit über "das" Mauve. Es gibt aber außerdem noch "den" Mauve. Der Mauve ist ein Original Pariser Petticoat der Schwarzen, meiner Gattin (Verlobungsgeschenk eines Vorgängers), und ihn hat sie natürlich in erster Linie gemeint. Besagtes Kleidungsstück (als pars pro toto) hatte mich vor Jahren veranlaßt, Celle nicht den Rücken zu kehren, als die Schwarze noch Fräulein Freudenberg war und ich schon abzudampfen gedachte, um in Frankfurt den Posten eines Raststätten-Syndikus anzunehmen oder jenseits des Rheines Mist zu karren, wenn ich als Pflastermaler versagt hätte." (Ein Jahr später verließ Grasshoff übrigens Celle und siedelte um nach Zwingenberg an der Weinstraße.)
Miesemase
Dieses kleine Stück "Merian"-Prosa atmet schon den Geist von Grasshoffs einzigem Roman, dem "Blauen Heinrich", der im Jahr 1980 veröffentlicht wurde . Im Genre des Schelmenromans erleben die Leser*innen die Kriegs- und Nachkriegsodyssee von Grasshoffs alter ego, dem Malerpoeten Heinrich Blaue - und als das schon genannte "Mölze" ist Celle der geografische Ankerpunkt der Nachkriegsgeschichten. Die euphorische Besprechung seines Freundes Georg Eyring in der "Zeit" hebt das literarisch Auf- und Anregende des Romans zwar treffend hervor, aber der erhoffte Erflog war dem Werk nicht beschieden. Das ist nicht wirklich verwunderlich, denn das Buch liefert eine Sicht auf Krieg und Nachkriegszeit, die zwar klar zwischen oben und unten zu unterscheiden weiß, aber sich als zu sperrig erweist gegenüber ethischen Fragestellungen. Dass erst das Fressen kam und dann die Moral, war nichts, mit dem sich das Feuilleton und auch nicht die Leser*innen anzufreunden vermochten. Hier eine Passage, die dies vielleicht illustriert:
"Auch Wladi Kleingeld, mein Freund und Gönner, die Nummer zwei der örtlichen KP, der sozusagen den noch schwächsten kapitalistischen Furz im Dunkeln ortete, bemerkte nichts, obwohl er jede Woche zweimal mittendrin saß in der fetten Wolke, dann nämlich, wenn er meiner Wenigkeit das dialektische Denken unterwuchtete, wir DAS MANIFEST durchnahmen, und er mir die Thesen Marxens kommentierte. Es war für Kleingeld beschlossene Sache: Er würde, da er alle Voraussetzungen gegeben sah, aus mir den ersten proletarischen Maler des Landes machen. Dafür aber, daß er mich kostenlos den ROTEN GLAUBEN lehrte, sowie für die Verheißung, bei Übernahme der politischen Geschäfte durch das Proletariat in Mölze gesellschaftlich aufzurücken - versteht sich: in der neuen Gesellschaft -, stellte ich ihm und seiner Ische, einer Schauspielerin vom Parktheater, meine Bude achtmal im Monat für die Dauer von zwei Stunden ebenso kostenlos zur Verfügung. Währenddessen trieb ich mich im Güterbahnhofgelände herum, vor der Wellblechbude des RIVERSIDE-CLUBS nach Kippen spähend, oder unternahm kleine Ausflüge in den Brigsener Wald, wo ich Pilze sammelte oder Bucheckern oder Verse ersann, völlig unpolitische, noch ohne jeden Klassenkampfgedanken, die später, allesamt vertont von Ari Slimka, durch Ulla Madison im NWDR gerade darum weite Verbreitung und ungeahnten Anklang fanden.
Die Mädchen von Manhatten,
die liegen in den Betten
und rauchen Zigaretten
und warten auf die große Show .. .
Sowas und Ähnliches. Will nur sagen: Manchmal findet der Scherenschleifer auf Nebengleisen oder Holzwegen dickere Brocken als auf der Hauptstrecke. Jedenfalls konnte ich mir davon ein paar Meter Wurst kaufen und endlich eine neue Hose.
Kulturschuster wiegte allerdings bedenklich die Bombe: "Meister, Sie schicken Ihre Muse auf den Strich". Dr. Viehaak, der gefeierte Stadtdichter und Herausgeber der Gral-Hefte, nahm die Produkte zum Anlaß einer tiefschürfenden Abhandlung über DAS TRIVIALE IN DER LYRIK. Dr. Klemmhage meinte, das sei meiner nicht würdig, und Wladi Kleingeld nannte es ganz einfach kapitalistische Kulturkotze. Ich versprach ihm denn auch, in mich zu gehen und lieber zu hungern, als mit Unkunst weiterhin dem Kapital in die Tentakel zu arbeiten."
Möwen, kleine weiße
Bekannt gemacht hat Grasshoff seine "Halunkenpostille", die - erstmals 1947 erschienen - Balladen und Moritaten versammelt, die - wie Georg Eyring schreibt - sich in der "Tradition antiker Satiriker, mittelalterlicher Vaganten, barocker Schäferdichter der derben Sorte bis hin zum jungen Brecht, zu Klabund, Tucholsky, Ringelnatz und Mehring" bewegen. Das Personal dieser Gedichte sind die Lumpen, Schnorrer, Penner, Kesselflicker und Diebe. Das ist der seit den 1950er Jahren bekannte Grasshoff, der hier und da auch einmal Eingang in Schulbücher gefunden hat. Der eher unbekannte Grasshoff ist der dann kommerziell noch erfolgreichere: nämlich der Schlagertexter. Hier knüpft er an die Hafenballaden und Spelunkensongs an, di sich auch in seinen Gedichtbänden finden, aber heruntergebrochen auf die Schnulze, wie er sie selbst genannt hat ("Ohne Schulzen wäre ich längst eines seligen Todes für die Kunst gestorben"). Sein heute noch bekanntester Song ist sicherlich "Nimm mich mit, Kapitän, auf die Reise", den angefangen von Hans Albers viele Sänger*innen der 1960er und 1970er Jahre im Programm hatten - und selbstverständlich jeder Shanty-Chor. Auf der Bekanntheitsskala folgen "Heimweh nach St. Pauli", das zum Repertoire von Freddy Quinn gehörte, und die "Kleine weiße Möwe", aufgenommen u.a. auch von Lala Andersen und Lolita. In den 1960ern erwärmten sich auch eine Reihe Schauspieler*innen für Grasshoffs Balladen. Davon zeugen LPs wie "Seeräuber-Report" oder "Damen dürfen erröten", wo seine Texte vorgetragen werden u.a. von Gustav Knuth, Wolfgang Neuss, Rene Deltgen, Günter Pfitzmann, Ralf Bendix, Ingrid van Bergen, Hans Messemer und Heinz Reinke (das "Who is Who" der 1960er).
Weniger bekannt dürfte sein, dass sich dann auch die Liedermachergeneration der späten 1960er, frühen 1970er für Grasshoff begeistern konnten. An erster Stelle steht hier das Duo "Schobert & Black". Schon auf ihrer ersten LP "Lästersongs und moralische Lieder" (1967) arbeiteten sie mit Grasshoff-Texten. Die zweite LP "Deutschland oder was beißt mich da" (1968) bestand komplett aus Grasshoffs Balladen, der auch das Covermotiv beisteuerte. Hier zwei Strophen aus "Neudeutsches Marschlied für Antimarschierer", die deutlich machen, warum Teile der neuen Liedermacher etwas mit Grasshoffs Texten anfangen konnten:
Der Haifisch schwimmt im grünen Sud
Und braucht nicht zu Marine
Glaubt nicht an Kreuz und Kirchengut
Und legt auch keine Mine
Er glaubt an seine Zähne
Und frisst sogar Kapläne
Der Kuckuck wohnt im grünen Forst
In Sachsen wie in Bayern
Er braucht auf keinen Fliegerhorst
Auch schmeißt er nicht mit Eiern
Doch lässt er kleine Ballen
Auf beide Deutschlands fallen
Auch an den 1966 erschienenen Übersetzungen der Balladen des schwedischen Nationaldichters Carl Michael Bellman durch Grasshoff ins Deutsche bediente sich die Liedermachergeneration, zuletzt im Jahr 1996 Dieter Süverkrüp auf der CD "Süverkrüp singt Graßhoffs Bellmann". Zusammen mit Lothar Lechleiter (d.i. "Black") und Pit Klein brachte Süverkrüp 1997 noch eine Hommage an den Dichter heraus, die CD "Hört mal her, ihr Zeitgenossen", auf der auch Grasshoff mit O-Tönen zu hören ist.
Malerei = keine TIEFE vortäuschen
Die eigentliche Leidenschaft Grasshoffs war aber die Malerei. RWLE Möller hat sein Werk anlässlich einer Ausstellung 1989 in Celle so eingeordnet: "Der Maler ist keinem "Ismus" zuzuordnen. Zu spüren sind aber Einflüsse und/oder Parallelentwicklungen von und zu Klee, Hofer, Pechstein, Kokoschka." Der Künstler selbst schrieb aus Hudson/Kanada, wohin er 1983 ausgewandert war, im Jahr 1985 an Oskar Ansull zu seiner Sicht auf Malerei:
"Der Hudson ist von Hudson so weit entfernt wie etwa Grönland von Langlingen. Suchen Sie mich eher in der Nähe New Yorks, denn das liegt nur 500 km südlicher. Daher: im Raum Montreal scheint die Sonne so hell und warm wie etwa in Milano (gleicher Breitengrad). Es ist nur die offene Meerseite, die den Unterschied zu Italien ausmacht. (Hier gibt's Kolibris u. schwalbengroße Schmetterlinge!) Die Winter allerdings sind "russisch", mir aber noch lieber als das Sabberwetter in Germany. (Obwohl sich auch hier schon der Greenhouse-Effekt bemerkbar macht: U.S.-Industrie!) Daß ich mich tagtäglich mit Wucht auf die Farben stürze wie nie zuvor, scheint mir last not least am Licht zu liegen u. seiner befruchtenden Einstrahlung (Binsenwahrheit) SONNE! [...]
Wie ich's mache? Ich reduziere bis zur "Moritat". [...] im GEMÄLDE sieht das so aus: Dargestellt wird auf Fläche. Will keine TIEFE vortäuschen, als: ohne Perspektive. Setze die Dinge scheibenartig zu=, neben= u. hintereinander auf das NOCHNICHT u. NICHTMEHR eines schwarzen Grundes. So gewinne ich ZEIT. Jedenfalls kommt's mir so vor. Was ich in Germany bisher gemalt habe - auch geschrieben, größtenteils - war Vorübung. Jetzt erst wird mir klar, wer ich bin, wo ich stehe und hingehöre. (Siehe Henry Miller in Big Sur im "Elfenbein=Monolog"). Ich habe Abstand genommen von meinen ererbten Friedhöfen u. beginne recht eigentlich zu leben. [...] Sei's drum. Die Farbe lädt ein, die Bilder locken, das Brot schmeckt (da selbst gebacken von Frau Gr.). Die SONNE scheint (!!!)"