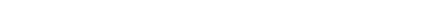Entscheidung am 4. November
 In der Ratssitzung am 4. November 2010 steht eine für die Entwicklung der Altstadt bedeutende Entscheidung an: Gibt es grünes Licht für das Gedo-Einkaufszentrum oder setzen sich die Gegner_innen durch?
In der Ratssitzung am 4. November 2010 steht eine für die Entwicklung der Altstadt bedeutende Entscheidung an: Gibt es grünes Licht für das Gedo-Einkaufszentrum oder setzen sich die Gegner_innen durch?
Die in der Initiative „ProAltstadt“ versammelten Einzelhändler und Gastronomen haben mit der von ihnen initiierten Demonstration Anfang Oktober ein deutliches Zeichen gesetzt. Sie trauen der Prognose nicht, dass alle von einem Einkaufszentrum (EKZ) profitieren würden, sondern befürchten im Gegenteil einen Verdrängungswettbewerb auf ihre Kosten. Wer sich um die Zukunft der Stadt als Ganzes Gedanken macht, muss andere Argumente bemühen – im Ergebnis bleibt auch hier nur ein klares Nein. {jcomments on}
„Hat Celle ein Hygiene-Problem?“ Mit dieser spaßhaft gemeinten Frage wies „ProAltstadt“ darauf hin, dass in der geplanten Altstadtgalerie rund 1500 qm für einen Drogeriemarkt ausgewiesen sind. Angesichts der in der Innenstadt schon vorhandenen Filialen von Rossmann, Müller, Schlecker & Co. mutet dies in der Tat kurios an. Aber die Frage trifft in zweierlei Hinsicht nicht den Kern. Zum einen geht es beim Aspekt der Zentralität von Städten ja eben genau darum, ein Warenangebot vorzuhalten, das den Bedarf der Einwohner übersteigt – also Kund_innen von außerhalb „anlockt“. Zum anderen verstehen sich Einkaufszentren tatsächlich als Antwort auf ein „Hygiene-Problem“, das Städte an sich, also als „Stadt“, haben.
Die „Versorgungs“-Funktion einer Stadt besteht u.a. darin, dass dort Waren und Dienstleistungen versammelt sind, die im Dorf oder im Stadtteil nur gelegentlich nachgefragt werden: z.B. das Hochzeitskleid oder die HNO-Ärztin, der Fotoapparat oder eine CD von Arcade Fire. Deshalb kaufen in den Geschäften der Stadt nicht nur die Städter, sondern eben auch Menschen aus den Vororten und den umliegenden Gemeinden. Die sich daraus ergebende Anhäufung von Waren macht dann nebenbei einen der Reize der Stadt aus.
Im Konkreten ist es nun so, dass sich durch ein Gedo- Einkaufszentrum die Verkaufsfläche der Altstadt um rund ein Drittel erhöhen würde. Der zu verkaufende „Kuchen“ wird also erheblich größer. Wenn sich nicht parallel der „Umsatz“ durch einen „Kaufkraftzufluss“ erhöht, werden etliche Händler Einbußen zu verzeichnen haben. Die „Alteingesessenen“ sehen sich einer Konkurrenz ausgesetzt, bei der sie ins Hintertreffen geraten könnten. Deshalb versprechen die EKZ-Planer, dass das vermehrte und differenzierte Warenangebot zwei Effekte hätte: Einerseits würde Geld, das bisher z.B. aus Celle nach Hannover abfließt, vor Ort bleiben. Zum andern würde Celle in der Konkurrenz der Standorte so aufgewertet, dass sogar Kund_innen neu angesprochen würden, die bisher um Celle einen Bogen gemacht hätten. Nebenbei wird ein Szenario entwickelt, das beim Verzicht auf ein EKZ eine weitere Schwächung in der Standortkonkurrenz prognostiziert – also ein Steigen des „Kaufkraftabflusses“, unter dem dann auch all jene leiden würden, die heute die Veränderung behindern. Um es beispielhaft an der Hygiene-Frage zu zeigen: Das Mehr an Hygiene-Artikeln soll durch den Zuwachs an Kund_innen aufgewogen werden; und würden in einer Stadt nur 12 statt 18 Parfümerie-Linien angeboten, gingen die Kund_innen sowieso bald dorthin, wo sie die Auswahl zwischen 18 Linien hätten.
Das Ganze wäre dann der alltägliche kapitalistische Wahnsinn mit all seinen Verrücktheiten. Dieses Mehr oder Weniger an Konsum-„Freiheit“ kann uns egal sein. Die Auseinandersetzung um Qualität – also die Fragen: ökologisch, fair, nah, sozial, nachhaltig etc. – kümmert weder die Initiative „ProAltstadt“ noch die Gedo-Planer.
Aber kommen wir zu der anderen Seite des „Hygiene“- Aspekts – und der spielt in der Diskussion bisher leider kaum eine Rolle.
 Ein Kennzeichen von Stadt ist die Koexistenz von Differentem, also dem Nebeneinander von sehr Unterschiedlichem. In der Stadt verdichten sich verschiedene soziale Gruppen und Lebensstile an einem Ort. Darum wollen junge Menschen in der Regel möglichst schnell vom Dorf in die nächstgelegene Stadt und von dort schnellstmöglich in die Großstadt.
Ein Kennzeichen von Stadt ist die Koexistenz von Differentem, also dem Nebeneinander von sehr Unterschiedlichem. In der Stadt verdichten sich verschiedene soziale Gruppen und Lebensstile an einem Ort. Darum wollen junge Menschen in der Regel möglichst schnell vom Dorf in die nächstgelegene Stadt und von dort schnellstmöglich in die Großstadt.
Der Soziologe Henri Lefevbre beschrieb diesen Reiz so: „Das Städtische definiert sich als der Ort, wo die Menschen sich gegenseitig auf die Füße treten, sich vor und inmitten einer Anhäufung von Objekten befinden, wo sie sich kreuzen und wieder kreuzen, bis sie den Faden der eigenen Tätigkeit verloren haben, Situationen derart miteinander verwirren, dass unvorhergesehene Situationen entstehen.“
Soziales Leben bildet sich in Räumen, die vielfältig nutzbar sind und Platz lassen für Unvorhergesehenes. Das war einmal die Stadt. Aber sie ist es immer weniger. Plätze und Straßen sind zunehmend funktionalisierter Raum. Ihr Gebrauchswert schwindet. Am Augenfälligsten ist dies in den Fußgängerzonen: Sie sind zugestellt mit Warenständern sowie Tischen und Stühlen, also dem gemeinen Gebrauch entzogen und umgewandelt in Bereiche kapitalistischer Verwertung. Auch das „Design“ der Plätze gleicht zunehmend der Funktionalität eines „McDonalds“-Restaurants: Kaum jemand nutzt sie noch zum längeren (konsumfreien) Verweilen. Gäbe es nicht die in sie vordringende gastronomische Verwertung, würde sich kaum jemand auf ihnen aufhalten. Deshalb ist die abwehrende „Zentro“-Idee der alteingesessenen Kaufleute, nämlich die ganze Stadt zu einer Art Einkaufszentrum zu machen, eigentlich nur die Projektion dieser Entwicklung in die Zukunft.
Trotzdem: Auch diese Zurichtung des Raums konnte bisher nicht verhindern, dass die Stadt ein Ort geblieben ist, in dem sich immer noch Abweichendes findet – nicht alles kauft und verkauft. Allein schon die in ihr konzentrierten Dienstleistungen (Banken, Ärzte, Behörden) führen auch Menschen in die Stadt, die dort aus Armutsgründen längst nicht mehr kaufen, sondern dafür die Discounter in ihren Stadtteilen oder Dörfern nutzen. Und manche der „Überflüssigen“ wollen wenigstens durch die räumliche Nähe Teil eines Spektakels werden, dem sie eigentlich nicht mehr zugehören sollen. Damit aber bleibt die Stadt ein Ort, an dem Unvorhergesehens passieren kann – ein Ort, den man nicht ganz sauber kriegt. Und der manchmal ein unverwechselbares Gesicht bekommen kann.
Dagegen steht das Einkaufszentrum als „Nicht-Ort“, wo diejenige urbane Realität verschwunden ist, die mit Unordnung (und Gefahr) gleichgesetzt wird.
Einkaufszentren stehen gegen soziale Unordnung. Wer sich in ihnen aufhält, ist nicht mehr Bürger_in, sondern nur noch Kund_in – und so in den Adelsstand des „Königs“ erhoben. Zwar simulieren die Zentren „Lebendigkeit“ und „Vielfalt“. Andererseits wird aber alles herausgehalten, was tatsächlich Urbanität, also Spontanität und Unordnung wäre.
 Damit sind wir beim „Hygiene-Problem“. Die Soziologen Aldo Legnaro und Almut Birenheide (siehe unten) sehen die Einkaufszentren geprägt von einem „Mythos der Reinheit“: „Deswegen kann man das permanente Bemühen um Sauberkeit und Reinheit an Nicht-Orten als ein Reinigungsritual betrachten, bei dem es nicht nur um die ubiquitäre [allgemein verbreitete] Bedeutung von Sauberkeit und Müllbeseitigung geht, sondern sich auch um die Befestigung von gefährdeten Grenzen handelt. Die Reinigungsrituale an diesen Orten verhelfen dementsprechend ebenso zur Abgrenzung von der Unordnung der Umgebung wie sie zur Herstellung einer neuen sowohl realen wie symbolischen Ordnung dienen. [...] Neben allen Mythen, die sie ansonsten noch präsentieren, stellen Nicht-Orte somit auch einen ‚Mythos der Reinheit’ aus, der vom komplementären ‚Mythos der urbanen Unordnung’ lebt und nicht zuletzt in dieser Gegenbildlichkeit ihre Attraktivität begründen dürfte.“
Damit sind wir beim „Hygiene-Problem“. Die Soziologen Aldo Legnaro und Almut Birenheide (siehe unten) sehen die Einkaufszentren geprägt von einem „Mythos der Reinheit“: „Deswegen kann man das permanente Bemühen um Sauberkeit und Reinheit an Nicht-Orten als ein Reinigungsritual betrachten, bei dem es nicht nur um die ubiquitäre [allgemein verbreitete] Bedeutung von Sauberkeit und Müllbeseitigung geht, sondern sich auch um die Befestigung von gefährdeten Grenzen handelt. Die Reinigungsrituale an diesen Orten verhelfen dementsprechend ebenso zur Abgrenzung von der Unordnung der Umgebung wie sie zur Herstellung einer neuen sowohl realen wie symbolischen Ordnung dienen. [...] Neben allen Mythen, die sie ansonsten noch präsentieren, stellen Nicht-Orte somit auch einen ‚Mythos der Reinheit’ aus, der vom komplementären ‚Mythos der urbanen Unordnung’ lebt und nicht zuletzt in dieser Gegenbildlichkeit ihre Attraktivität begründen dürfte.“
Für große Städte wie Hamburg oder Hannover mögen die Galerien insoweit „Ergänzungen“ darstellen, als sie sich in der Stadt einnisten, sie aber nicht zu prägen vermögen. In einer kleinen Stadt wie Celle stellt sich das anders dar. Wo es um die strukturierte Vermarktung eines Drittels der Verkaufsfläche der Stadt geht, ist eine Dominanz vorhersehbar. In der Konsequenz kann dies zu einer geteilten Stadt führen: einerseits die schmuddelige urbane Wirklichkeit mit Leerständen, Bettlern, Trinkern und der bedrohlichen Anwesenheit von Armut, andererseits die durch keinen dieser Faktoren getrübte „Wohlfühl-Welt“ der Einkaufsgalerie. Die Teilung in „Stadt“ und „Galerie“ ist absehbar. Was bedeutet das für die „Stadt“? Mit etwas Pech landet sie in einer Abwärts-Spirale, bei der die halbwegs erfolgreichen „Kleinen“ versuchen werden, sich ein Plätzchen unter dem Dach des Gedo-Center zu sichern. Und der verbleibende Rest wird permanent anmahnen, dass die „Stadt“ werden müsse wie ihr „Gegenbild“: also Schluss sein müsse mit der Unordnung.